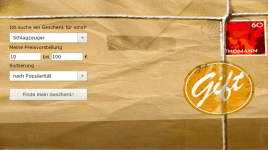Wer heutzutage locker und unbeschwert eine Performance on stage hinlegen möchte, die nicht in Kabelsalat endet, findet etliche Funksysteme, die den Bühnenauftritt erleichtern. Ganz gleich, ob erschwingliches Einsteigermodell, solide Mittelklasse oder leistungsstarkes Profi-Modell … mittlerweile findet sich für jeden Geldbeutel ein passendes Wireless-System (Produkttipps hier). Oftmals unterscheiden sich die Modelle nur in ihren Arbeitsfrequenzen, doch weil es bei der Zuteilung zulässiger Frequenzen in den letzten Jahren viel Bewegung gegeben hat, steht so mancher wie der „Ochs vorm Berg“ da: Was bedeuten die vielen Begriffe? Auf welche Funkstrecken-Frequenz soll ich setzen? Und worin unterscheiden sie sich?
Von „Diversity“ bis „Lavalier“ – grundlegende Begriffe
Systeme für drahtlose Signalübertragungen setzen statt auf Kabelverbindungen auf eine Übertragung per Funk. Daher trifft man hier immer wieder auf die englische Bezeichnung „wireless“ (dt. kabellos). Für ein solches Drahtlossystem wird auf der einen Seite ein Sender benötigt, der ein eingespeistes Audiosignal per Funkverbindung zu einem Empfänger übermittelt Er greift das Signal auf und lässt es von dort aus per Kabel weiter verarbeiten. Die erfolgreiche Verbindung von Transmitter (Sender) und Receiver (Empfänger) wird dann als Funkstrecke bezeichnet. Soweit so einfach.
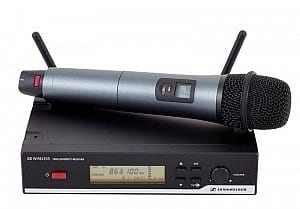 Wie der jeweilige Sender gefüttert wird (Mikrofon, Instrumentenausgang, Line-Signal) entscheidet darüber, welcher Art von Wireless-System für den Musiker in Frage kommt. Für Sänger und Moderatoren gibt es Mikrofon-Drahtlosanlagen mit verschiedenen Mikrofontypen, wie den klassischen Handheld-Mikrofonen, kleine Lavalier-Mikrofone zum Anstecken an den Kragen oder auch Headsets mit oder ohne Monitoring-Kopfhörer. Instrumentalisten können auf Funksysteme für Gitarre und Bass oder Funkanlagen mit Instrumentenmikrofonen zurückgreifen.
Wie der jeweilige Sender gefüttert wird (Mikrofon, Instrumentenausgang, Line-Signal) entscheidet darüber, welcher Art von Wireless-System für den Musiker in Frage kommt. Für Sänger und Moderatoren gibt es Mikrofon-Drahtlosanlagen mit verschiedenen Mikrofontypen, wie den klassischen Handheld-Mikrofonen, kleine Lavalier-Mikrofone zum Anstecken an den Kragen oder auch Headsets mit oder ohne Monitoring-Kopfhörer. Instrumentalisten können auf Funksysteme für Gitarre und Bass oder Funkanlagen mit Instrumentenmikrofonen zurückgreifen.
 Damit ihr die Funkverbindung möglichst reibungslos und ohne Aussetzer im Signal nutzen könnt, setzen viele Geräte auf die sogenannte Diversity-Technik. Sie verhindert, dass Funkwellen, die von Wänden oder Decken gegenphasig reflektiert werden, zu Aussetzern (Dropouts) im Funkbetrieb führen. Betroffen von diesem Problem seid ihr am ehesten, wenn ihr eure Drahtlosanlagen (vor allem über größere Entfernungen hinweg) indoor und in Hallen betreiben möchtet.
Damit ihr die Funkverbindung möglichst reibungslos und ohne Aussetzer im Signal nutzen könnt, setzen viele Geräte auf die sogenannte Diversity-Technik. Sie verhindert, dass Funkwellen, die von Wänden oder Decken gegenphasig reflektiert werden, zu Aussetzern (Dropouts) im Funkbetrieb führen. Betroffen von diesem Problem seid ihr am ehesten, wenn ihr eure Drahtlosanlagen (vor allem über größere Entfernungen hinweg) indoor und in Hallen betreiben möchtet.
Die wichtigsten Diversity-Verfahren sind das Antennen-Switching und das als „True Diversity“ bezeichnete Audioswitching. Beim ersten wird der Empfang zwischen zwei ausreichend weit voneinander entfernten Antennen umgeschaltet, je nachdem welche das  Audiosignal zuverlässiger bzw. stärker empfängt. Hier können mitunter „Knackser“ auftreten. Beim True Diversity wird dagegen das Audiosignal doppelt an zwei Empfänger mit separaten Antennen gesendet. Der Receiver sucht dann selbsttätig das Audiosignal mit der besseren Qualität aus. Ein Knacken beim automatischen Umschalten ist hier in der Regel ausgeschlossen.
Audiosignal zuverlässiger bzw. stärker empfängt. Hier können mitunter „Knackser“ auftreten. Beim True Diversity wird dagegen das Audiosignal doppelt an zwei Empfänger mit separaten Antennen gesendet. Der Receiver sucht dann selbsttätig das Audiosignal mit der besseren Qualität aus. Ein Knacken beim automatischen Umschalten ist hier in der Regel ausgeschlossen.
Geräte mit Pilotton ermöglichen eine Betriebskontrolle und Funktionen wie automatisches Standby. Als Squelch bezeichnet man eine Rauschsperre, die per Threshold-Regler justiert wird. Sie sorgt dafür, dass das Audiosignal bei zu schwachem Signalempfang nicht aufrauscht.
Die Stromversorgung eines Funksenders erfolgt über Batterien oder Akkus. Gerade für Funkstrecken-Fans, die ihre Geräte häufig nutzen, kann es sich durchaus lohnen einmalig etwas tiefer in die Tasche zu greifen und einen langlebigen Akku samt Ladestation anzuschaffen. Das senkt auf Dauer die Betriebskosten. Bei regelmäßigem Bühneneinsatz und häufigem Transport solltet ihr dem Funksystem eurer Wahl außerdem ein Rack-Kit oder eine Befestigungsschiene gönnen, mit dessen Hilfe ihr es sicher in einem Flightcase oder einer Festinstallation verschrauben könnt.
Und selbstverständlich könnt ihr auf der Bühne auch mehrere Funkstrecken parallel einsetzen, beispielsweise eine für den Sänger, zwei für die Gitarristen und so weiter. Damit es dabei nicht zu einem großen Kuddelmuddel kommt, muss das Signal jeder Sender-Empfänger-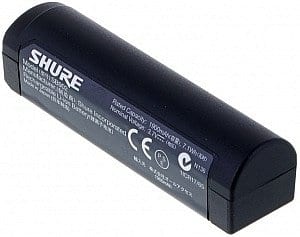 Kombination auf einem separaten Funkkanal übertragen werden. Um Interferenzen (störende Wellenformänderung durch gegenseitige Überlagerung) zu vermeiden und Intermodulationen (Störungen durch Frequenzsummen und -differenzen) auszuschließen, unterscheiden sich die verschiedenen Kanäle, auf denen das Drahtlossystem sendet und empfängt, in ihren Frequenzen. Viele Funksysteme können außerdem automatisch regeln, welches Zusammenspiel von Frequenzen in der Praxis harmoniert.
Kombination auf einem separaten Funkkanal übertragen werden. Um Interferenzen (störende Wellenformänderung durch gegenseitige Überlagerung) zu vermeiden und Intermodulationen (Störungen durch Frequenzsummen und -differenzen) auszuschließen, unterscheiden sich die verschiedenen Kanäle, auf denen das Drahtlossystem sendet und empfängt, in ihren Frequenzen. Viele Funksysteme können außerdem automatisch regeln, welches Zusammenspiel von Frequenzen in der Praxis harmoniert.
Nicht selten werden Kanäle, die miteinander kompatibel sind, vom Hersteller als Gruppen angelegt. Sofern ihr Funksysteme desselben Herstellers verwendet, könnt ihr euch dann als Nutzer beim Zuweisen von Kanälen zu euren Funkstrecken ganz einfach innerhalb einer solchen Gruppe bewegen, damit der Funkbetrieb später reibungslos abläuft.
Was ihr beachten müsst – rechtliche Grundlagen
 Welche Frequenzbereiche für die Kanäle zur Verfügung stehen, wird für den innerdeutschen Bereich von der Bundesnetzagentur im Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt und ist keineswegs in Stein gemeißelt. Etliche der Frequenzen, die von Musiker noch vor einigen Jahren kostenfrei für ihre Funkstrecken nutzen konnten, werden heute anderweitig genutzt. Wer sich nicht auskennt oder nichtsahnend Bereich des Illegalen und muss als „Störer“ sogar mit Bußgeldern rechnen.
Welche Frequenzbereiche für die Kanäle zur Verfügung stehen, wird für den innerdeutschen Bereich von der Bundesnetzagentur im Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt und ist keineswegs in Stein gemeißelt. Etliche der Frequenzen, die von Musiker noch vor einigen Jahren kostenfrei für ihre Funkstrecken nutzen konnten, werden heute anderweitig genutzt. Wer sich nicht auskennt oder nichtsahnend Bereich des Illegalen und muss als „Störer“ sogar mit Bußgeldern rechnen.
Heute angebotene Funksysteme für Musiker setzen durch die Reihen hindurch auf HF-Signale („HF“ steht dabei für hochfrequent). Zahlreiche Hersteller bieten ihre Drahtlosanlagen mit identischer Ausstattung, aber für verschiedene Frequenzen an. Meist gibt ein entsprechendes Kürzel hinter dem Gerätenamen an, in welchem Frequenzbereich die Signalübertragung stattfindet.
 Wer gelegentlich als Amateurmusiker auftritt, gilt als Privatperson und kann sein Funksystem ohne vorherige behördliche Anmeldung nutzen. Für diese Gruppe von Nutzern sind bestimmte Frequenzbereiche reserviert, die allerdings im Verhältnis zu den Profi-Frequenzen stark begrenzt sind. Deshalb gestaltet sich das Einrichten großer Funkstrecken-Setups hier eher schwierig.
Wer gelegentlich als Amateurmusiker auftritt, gilt als Privatperson und kann sein Funksystem ohne vorherige behördliche Anmeldung nutzen. Für diese Gruppe von Nutzern sind bestimmte Frequenzbereiche reserviert, die allerdings im Verhältnis zu den Profi-Frequenzen stark begrenzt sind. Deshalb gestaltet sich das Einrichten großer Funkstrecken-Setups hier eher schwierig.
Anders sieht es aus, wenn ihr Veranstalter seid oder regelmäßige Auftritte als Profi hinlegt und dabei auf Drahtlossysteme setzt. Denn als professioneller Anwender (und das bedeutet „als regelmäßiger Nutzer“) seid ihr einerseits dazu verpflichtet, den Betrieb eurer Funkstrecken anzumelden. Andererseits stehen auch dieser Nutzergruppe bestimmte Frequenzbereiche zur Verfügung, die dafür aber so großzügig angelegt sind, dass sie den Betrieb komplexer Drahtlosanlagen ermöglichen.
Warum, wie und wo? – Vorteile, Möglichkeiten und Einsatzorte
Aber welcher Funkbereich ist denn nun der passende für euch? Die Antwort hängt stark davon ab, wie und wie viele Drahtlossysteme ihr zeitgleich nutzen möchtet.
 Werfen wir kurz einen Blick auf die verschiedenen Frequenzbereiche. Fünf anmeldefreie Bereiche stehen Amateuren zur Verfügung. Die niedrigsten Frequenzen weist das mittlerweile obsolete VHF-Band auf, das von 174 bis 230 MHz reicht. Es ermöglicht die Nutzung einer kleinen Anzahl Kanäle und ist nicht sonderlich betriebssicher.
Werfen wir kurz einen Blick auf die verschiedenen Frequenzbereiche. Fünf anmeldefreie Bereiche stehen Amateuren zur Verfügung. Die niedrigsten Frequenzen weist das mittlerweile obsolete VHF-Band auf, das von 174 bis 230 MHz reicht. Es ermöglicht die Nutzung einer kleinen Anzahl Kanäle und ist nicht sonderlich betriebssicher.
Die sogenannte „Mittenlücke“ im LTE-Band umfasst die Frequenzen von 823 bis 832 MHz. Dieser Frequenzbereich ist ausreichend breit angelegt, um auf kleinen bis mittelgroßen Events ein bis zwei Handvoll paralleler Funkstrecken zu betreiben. Allerdings kann es im Bereich von LTE-Sendemasten zu Betriebsstörungen kommen.
Das europaweit harmonisierte Frequenzband (ISM-Bereich) liegt zwischen 863 und 865 MHz. Aufgrund seiner geringen Bandbreite eignet es sich für die Installation von nur zwei bis maximal vier parallel betriebenen Funkstrecken. Ihr solltet jedoch wissen, dass auch so manche Haustechnik (z. B. Funkkopfhörer oder Babyphones) auf diesen Frequenzbereich zurückgreift. Je nach Einsatzort treten deshalb hier Störungen wahrscheinlicher auf als in anderen Frequenzbereichen.
Darüber hinaus gibt es noch die anmeldefreien Frequenzbereiche von
1. a) 1492 bis 1518 MHz und
2. b) 1785 bis 1805 MHz
die allerdings a) ausschließlich in Gebäuden genutzt werden dürfen bzw. b) lange Zeit anfällig für Dropouts waren. Einige Hersteller versprechen hierfür aber den parallelen Betrieb von bis zu 12 Funkstrecken.
 Außerdem kommen immer mehr Drahtlossysteme auf den Markt, die das Audiosignal digital gewandelt im 2,4 GHz-Bereich übertragen. Er wird von WLANs genutzt und steht auch für Funksysteme anmeldefrei zur Verfügung. Jedoch bietet er nur verhältnismäßig geringe Reichweiten und ist zudem latenzanfällig. Hier ist eine Installation von immerhin bis zu fünf oder bestenfalls sechs parallelen Funkstrecken möglich.
Außerdem kommen immer mehr Drahtlossysteme auf den Markt, die das Audiosignal digital gewandelt im 2,4 GHz-Bereich übertragen. Er wird von WLANs genutzt und steht auch für Funksysteme anmeldefrei zur Verfügung. Jedoch bietet er nur verhältnismäßig geringe Reichweiten und ist zudem latenzanfällig. Hier ist eine Installation von immerhin bis zu fünf oder bestenfalls sechs parallelen Funkstrecken möglich.
Als professioneller Anwender möchtet ihr eventuell eine Festinstallation komplexerer Funksysteme vornehmen und setzt auf hohe Betriebssicherheit. Dann sind die Frequenzbereiche 470 bis 608 MHz, 614 bis 703 MHz und 733 bis 758 MHz für euch optimal.
Bitte hier unterschreiben … Kosten und Anmeldung
Die Anmeldung der Frequenzzuweisung erfolgt bei den Außenstellen der Bundesnetzagentur. Eine Liste dieser Büros findet ihr unter dem Link im Abschnitt „Frequenzzuteilung“. Das passende Formular dazu findet ihr unter diesem Link hier.
 Die Forderungen für die Frequenzzuteilungen bestehen aus einmaligen Gebühren i. H. v. 130,-€ und Frequenznutzungsbeiträgen. Pro Sender werden dabei etwa sieben bis zehn Euro fällig. Meldet ihr für dasselbe Jahr weitere Drahtlossystem an, so zahlt ihr für die erneute Anmeldung nur noch die halbe Gebühr zuzüglich des entstehenden Nutzungsbeitrags.
Die Forderungen für die Frequenzzuteilungen bestehen aus einmaligen Gebühren i. H. v. 130,-€ und Frequenznutzungsbeiträgen. Pro Sender werden dabei etwa sieben bis zehn Euro fällig. Meldet ihr für dasselbe Jahr weitere Drahtlossystem an, so zahlt ihr für die erneute Anmeldung nur noch die halbe Gebühr zuzüglich des entstehenden Nutzungsbeitrags.
Die tatsächliche Nutzungsdauer wird übrigens nicht berücksichtigt. Wer also ein entsprechend anmeldepflichtiges Gerät besitzt, der ist aufgrund der einfachen Frequenzzuteilung bereits zur Zahlung verpflichtet. Die Kosten sind dabei für verschiedene Nutzergruppen unterschiedlich hoch und werden jährlich neu bestimmt, so dass ihr euch auf dem Laufenden halten solltet.
Fazit
 Das alles klingt auf den ersten Blick verwirrend und unübersichtlich. Habt ihr euch aber erst klar gemacht, wie und wo ihr eure Drahtlosanlage(n) nutzen möchtet, könnt ihr eure Voraussetzungen auf einem Zettel notieren und die benötigten Features und passenden Frequenzbereiche am besten gleich dazu. So könnt ihr einen Großteil des immensen Angebots an Funksystemen ausschließen und findet im Handumdrehen das passende Wireless-System für euch. Als Hobbymusiker steht euch eine Vielzahl von Frequenzen kostenlos zur Verfügung. Seid ihr Profi, dann werdet ihr sicher gerne auf die breiter angelegten anmeldepflichtigen Frequenzbereiche zurückgreifen.
Das alles klingt auf den ersten Blick verwirrend und unübersichtlich. Habt ihr euch aber erst klar gemacht, wie und wo ihr eure Drahtlosanlage(n) nutzen möchtet, könnt ihr eure Voraussetzungen auf einem Zettel notieren und die benötigten Features und passenden Frequenzbereiche am besten gleich dazu. So könnt ihr einen Großteil des immensen Angebots an Funksystemen ausschließen und findet im Handumdrehen das passende Wireless-System für euch. Als Hobbymusiker steht euch eine Vielzahl von Frequenzen kostenlos zur Verfügung. Seid ihr Profi, dann werdet ihr sicher gerne auf die breiter angelegten anmeldepflichtigen Frequenzbereiche zurückgreifen.
Wer übrigens als professioneller Anwender (sehr) langfristig auf Nummer sicher gehen möchte, sollte auch im Bereich der Profi-Frequenzen lieber zu Geräten mit tieferen Übertragungsfrequenzen greifen. Denn das Feld der Funkfrequenzen ist hart umkämpft und im ständigen Wandel.
Produkttipps zu Funk- und Wireless-Systemen findet ihr hier auf dem t.blog.
Also dann: guten Empfang!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen